Digitale Signalverarbeitung
Navigationshilfe
Diese Navigationshilfe zeigt die ersten Schritte zur Verwendung der Präsentation. Sie kann mit ⟶ (Pfeiltaste rechts) übersprungen werden.
Navigation
Zwischen den Folien und Abschnitten kann man mittels der Pfeiltasten hin- und herspringen, dazu kann man auch die Pfeiltasten am Computer nutzen.

- Pfeil runter und hoch: Nächste / Vorherige Folie
- Pfeil rechts und links: Nächster / Vorheriger Abschnitt
- Leertaste oder „n“: Der Reihe nach alle Elemente in Folien aufdecken oder zur nächsten Folie blättern
- Shift-Leertaste oder „p“: Der Reihe nach Elemente rückwärts zudecken oder zur vorherigen Folie blättern
Weitere Funktionen
Mit ein paar Tastenkürzeln können weitere Funktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten sind:
- F1
- Help / Hilfe
- o
- Overview / Übersicht aller Folien
- s
- Speaker View / Referentenansicht
- f
- Full Screen / Vollbildmodus
- b
- Break, Black, Pause / Ausblenden der Präsentation
- Alt-Click
- In die Folie hin- oder herauszoomen
Übersicht
Die Präsentation ist zweidimensional aufgebaut. Dadurch sind in Spalten die einzelnen Abschnitte eines Kapitels und in den Reihen die Folien zu den Abschnitten.
Tippt man ein „o“ ein, bekommt man eine Übersicht über alle Folien des jeweiligen Kapitels. Das hilft sich zunächst einen Überblick zu verschaffen oder sich zu orientieren, wenn man das Gefühlt hat sich „verlaufen“ zu haben. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten.
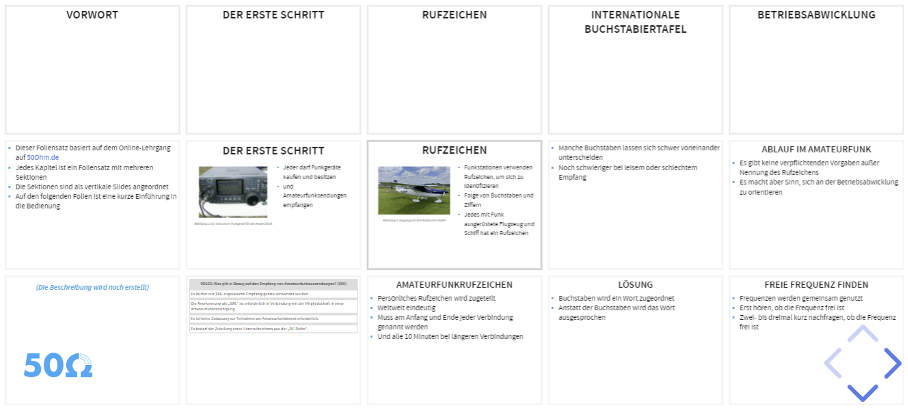
Durch Anklicken einer Folie wird diese präsentiert.
Referentenansicht
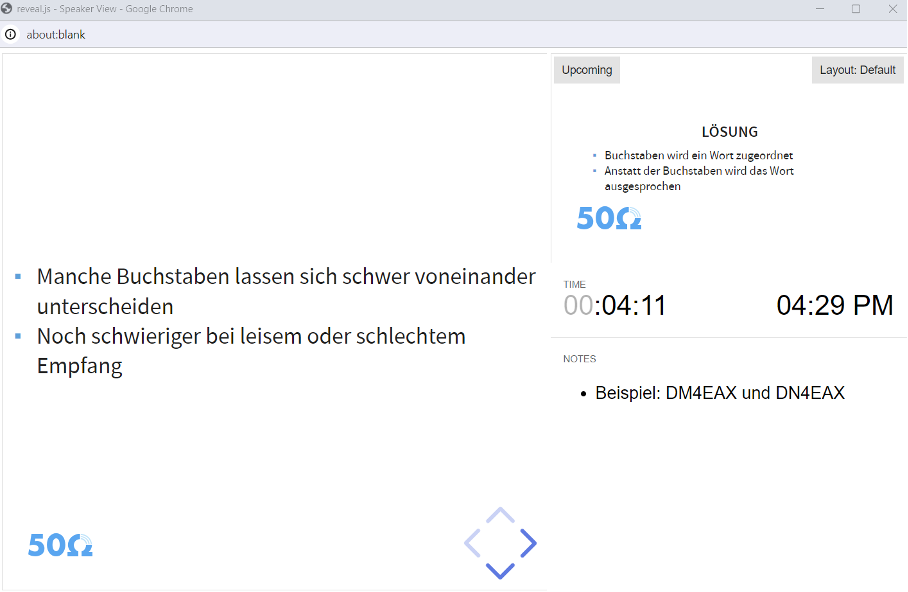
Tippt man ein „s“ ein, bekommt man ein neues Fenster, die Referentenansicht.
Indem man „Layout“ auswählt, kann man zwischen verschieden Anordnungen der Elemente auswählen.
Die Referentenansicht bietet folgende Elemente:
- Links sieht man die aktuelle Folie
- Rechts oben sieht man die nächste Folie
- Rechts in der Mitte Hilfsmittel zur Zeiteinteilung
- Rechts unten, die „Notizen für den Vortragenden“
- Unten die Pfeile zur Navigation
Praxistipps zur Referentenansicht
- Wenn man mit einem Projektor arbeitet, stellt man im Betriebssystem die Nutzung von 2 Monitoren ein: Die Referentenansicht wird dann zum Beispiel auf dem Laptop angezeigt, während die Teilnehmer die Präsentation angezeigt bekommen.
- Bei einer Online-Präsentation, wie beispielsweise auf TREFF.darc.de präsentiert man den Browser-Tab und navigiert im „Speaker View“ Fenster.
- Die Referentenansicht bezieht sich immer auf ein Kapitel. Am Ende des Kapitels muss sie geschlossen werden, um im neuen Kapitel eine neue Referentenansicht zu öffnen.
- Um mit dem Mauszeiger etwas zu markieren oder den Zoom zu verwenden, muss mit der Maus auf den Bildschirm mit der Präsentation gewechselt werden.
Vollbild
Tippt man ein „f“ ein, wird die aktuelle Folie im Vollbild angezeigt. Mit „Esc“ kann man diesen wieder verlassen.
Das ist insbesondere für den Bildschirm mit der Präsentation für das Publikum praktisch.
Ausblenden
Tippt man ein „b“ ein, wird die Präsentation ausgeblendet.
Sie kann wie folgt wieder eingeblendet werden:
- Durch klicken in das Fenster.
- Durch nochmaliges Drücken von „b“.
- Durch klicken der Schaltfläche „Resume presentation:
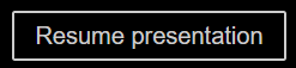
Zoom
Bei gedrückter Alt-Taste und einem Mausklick in der Präsentation wird in diesen Teil hineingezoomt. Das ist praktisch, um Details von Schaltungen hervorzuheben. Durch einen nochmaligen Mausklick zusammen mit Alt wird wieder herausgezoomt.
Das Zoomen funktioniert nur im ausgewählten Fenster. Die Referentenansicht ist hier nicht mit dem Präsenationsansicht gesynct.
Digitale Signalverarbeitung
- Im Bereich der Funktechnik spricht man bei Geräten, die mittels digitaler Signalverarbeitung arbeiten von sogenannten SDR-Geräten.
- SDR steht dabei für Software Defined Radio.
- In diesen Geräten ist zumindest ein Teil der Signalverarbeitung in Software realisiert.
- Dieses hat einen Kostenvorteil und bringt eine große Flexibilität mit sich.
A: Zumindest im NF-Bereich wird Analogtechnik eingesetzt, um besseren Klang zu erreichen.
B: Es werden spezielle Antennenanschlüsse für digitale Signale verwendet.
C: Die Aussendung bzw. der Empfang erfolgt über das Internet und nicht per Funk.
D: Zumindest ein Teil der Signalaufbereitung ist in Software realisiert.
A/D-Umsetzer
- Damit die Daten digital verarbeitet werden können, müssen sie zunächst digitalisiert werden.
- Dazu wird das analoge Signal mittels eines Analog-Digital Umsetzers (A/D-Umsetzer) in digitale Werte umgesetzt.
- Hierbei wird das analoge Signal in festen Zeitintervallen abgetastet und in einem digitalen Wertebereich (z.B. von -128 bis +127) abgebildet.
- Die einzelnen gemessenen Signalwerte werden als Samples (Proben) bezeichnet.
A: von Rauschen befreit werden.
B: digitalisiert werden.
C: demoduliert werden.
D: von Oberschwingungen befreit werden.
D/A-Umsetzer
- Nach der digitalen Verarbeitung des Signals wird es in einem Digital-Analog-Umsetzer (D/A-Umsetzer) wieder in ein analoges Signal verwandelt.
A: 1: A/D-Umsetzer, 2: D/A-Umsetzer
B: 1: D/A-Umsetzer, 2: A/D-Umsetzer
C: beides D/A-Umsetzer
D: beides A/D-Umsetzer
Sampling und Quantisierung
Sampling: Von analog zu digital
- Analoge Signale werden mittels Sampling in digitale Werte umgewandelt
- Abtastung erfolgt in definierten Zeitintervallen – nur Momentanzustände werden gemessen
- Analoge Signale sind zeitkontinuierlich, da sie keine kleinste zeitliche Auflösung besitzen
- Digitale Samples sind zeitdiskret, da ein festes Abtastintervall existiert
Hier gibt es die Möglichkeit das Ganze nochmal auszuprobieren. Ein zeitkontinuierliches Sinus-Signal wird von einem AD-Umsetzer digitalisiert und anschließend wieder von einem DA-Umsetzer in ein analoges Signal gewandelt. An den Reglern kann man die Zeitquantisierung und die Wertquantisierung der AD/DA-Umsetzer einstellen.
| Zeit-Quantisierung: |
1024 Samples/s.
|
|
| Wert-Quantisierung: |
16 bits
|
Wertkontinuität vs. Wertdiskretheit
- Analoge Signale können beliebige Spannungswerte annehmen – sie sind wertkontinuierlich
- Bei der Digitalisierung gibt es nur begrenzte Abstufungen (z. B. -128 bis +127) – Samples sind wertdiskret
- Zwischen zwei Spannungsstufen muss der A/D-Umsetzer eine Entscheidung treffen (Quantisierung)
Praktisches Beispiel: Dimmer vs. Stufenschalter
- Ein analoger Dimmer erlaubt feine, stufenlose Helligkeitseinstellungen
- Ein Stufenschalter (z. B. 5 Stufen) ermöglicht nur feste Helligkeitswerte – Zwischenstufen sind nicht möglich
- Quantisierung: Auswahl der nächstpassenden Stufe, um den analogen Wert abzubilden
Sampling
- Der Prozess, ein analoges, zeitkontinuierliches Signal mittels A/D-Umsetzung in ein digitales Signal zu überführen
- Das digitale Signal besteht aus einzelnen, zeitdiskreten Samples
A: Codierung
B: Zeitmultiplexing
C: Quantisierung
D: Sampling
Samplingrate
- Geschwindigkeit, mit der ein A/D-Umsetzer Abtastungen vornimmt
- Definiert als Anzahl der Samples pro Zeiteinheit (z. B. pro Sekunde)
- Einheit: Samples/s (z. B. 44,100 Samples/s bei CDs, oft als 44,1 ksps angegeben)
A: Abtastungen je Zeiteinheit
B: Abtastungen mal Zeit
C: Abtastungen mal Samples
D: Abtastungen je Hertz
Abtasttheorem
Der Prozess des Samplings
- Analoge Signale werden in diskrete Samples umgewandelt
- Sampling: Abtastung eines kontinuierlichen Signals in festgelegten Zeitabständen
- Vergleichbar mit einer Kamera, die in regelmäßigen Intervallen Bilder aufnimmt
Sampling – Das Kamerabeispiel
- Eine Kamera nimmt z. B. 24 Bilder pro Sekunde auf
- Zwischen den Bildern können schnelle Bewegungen auftreten, die nicht erfasst werden
- Wie bei der Kamera kann ein plötzliches Ereignis (z. B. eine Fliege) zwischen zwei Aufnahmen verloren gehen
- Dadurch entsteht ein Verlust an zeitlicher Information
Informationsverlust und Rekonstruktionsgrenze
- Zwischen den Samples können schnelle Signaländerungen unentdeckt bleiben
- Für eine fehlerfreie Rekonstruktion muss vor und nach jedem Signalwechsel ein Sample vorliegen
- Ist dies nicht der Fall, gehen Details verloren – Aliasing tritt auf
Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
- Für ein Signal mit maximaler Frequenz $f_{max}$ muss die Abtastrate $\gt 2 \cdot f_{max}$ betragen
- Nur so können alle Signalwechsel korrekt erfasst und rekonstruiert werden
- Wird diese Grenze unterschritten, entstehen Alias-Effekte
A: beim Senden mit mehrelementigen Richtantennen auftreten, deren Elementabstand größer als die halbe Wellenlänge ist.
B: bei Mehrwegeausbreitung mit Laufzeitunterschieden auftreten, die höher als die halbe Dauer einer Schwingung des Trägers sind.
C: bei der Abtastung von Frequenzanteilen auftreten, die höher als die halbe Abtastfrequenz sind.
D: beim Empfang eines Signals auftreten, von dessen Spektrum mehr als die Hälfte gestört ist.
Praktisches Beispiel: CD-Player
- CD-Player arbeiten typischerweise mit 44,1 ksps (44.100 Samples pro Sekunde)
- Daraus folgt: Frequenzen bis ca.
22 kHz können korrekt abgebildet werden - Dies entspricht dem HiFi-Frequenzbereich guter Stereoanlagen
- Merke: Die Abtastfrequenz sollte stets knapp über dem Doppelten der maximal zu verarbeitenden Frequenz liegen
A: besagt, dass theoretisch eine unendliche Abtastrate erforderlich ist, um ein bandbegrenztes Signal fehlerfrei zu rekonstruieren.
B: bestimmt die für eine fehlerfreie Rekonstruktion eines Signals theoretisch notwendige minimale Abtastrate.
C: besagt, dass unabhängig von der Art der vorherrschenden Störungen eines Übertragungskanals theoretisch eine unbegrenzte Datenübertragungsrate erzielt werden kann.
D: bestimmt die maximale Bandbreite, die durch eine Übertragung mit einer bestimmten Datenübertragungsrate theoretisch belegt werden kann.
A: knapp über $2 \cdot f_{\textrm{max}}$
B: knapp über $f_{\textrm{max}}$
C: knapp unter $\dfrac{f_{\mathrm{max}}}{2}$
D: knapp unter $f_{\textrm{max}}$
A: 2400 Samples/s
B: 4800 Samples/s
C: 4000 Samples/s
D: 9600 Samples/s
Quantisierung
Quantisierung in der A/D-Umsetzung
- Zeitkontinuierliche Signale werden durch A/D-Umsetzung in digitale Samples überführt
- Bei der Quantisierung werden kontinuierliche analoge Werte in feste Stufen (wertdiskret) abgebildet
- Ein analoges, wertkontinuierliches Signal wird somit in ein gestuftes, wertdiskretes Signal transformiert
A: Quantisierung
B: Codierung
C: Raummultiplexing
D: Sampling
Analog-Digital-Umsetzer (ADC)
Funktion des A/D-Umsetzers
- Wandelt analoge Eingangssignale in digitale Samples um
- Essentiell für die Digitalisierung und Weiterverarbeitung von Signalen
Aliasing und Antialiasing
- Abtasttheorem: Für fehlerfreie Rekonstruktion muss die Abtastrate $\gt 2 \cdot f_{max}$ betragen
- Signale oberhalb der maximal verarbeitbaren Frequenz können als fehlerhafte Aliases erscheinen
- Antialiasing-Filter (Tiefpass- oder Bandpassfilter) unterdrücken unerwünschte hohe Frequenzen
- Schützen den A/D-Umsetzer vor fehlerhaften Aliasing-Effekten
A: 1: Analog-Digital-Umsetzer, 2: Antialiasing-Filter, 3: Abtastratengenerator
B: 1: Analog-Digital-Umsetzer, 2: Abtastratengenerator, 3: Antialiasing-Filter
C: 1: Antialiasing-Filter, 2: Abtastratengenerator, 3: Analog-Digital-Umsetzer
D: 1: Abtastratengenerator, 2: Antialiasing-Filter, 3: Analog-Digital-Umsetzer
Taktgenerator (Abtastratengenerator)
- Erzeugt den exakten zeitlichen Takt für die Abtastung
- Bestimmt, wie oft pro Sekunde ein Sample erfasst wird
- Kann fest eingestellt oder durch Steuerung (z. B. Mikrocontroller) geregelt werden
Quantisierung und Quantisierungsfehler
- Bei der A/D-Umsetzung werden analoge Amplitudenwerte in feste Stufen abgebildet
- Dies führt zu einer wertdiskreten Darstellung des ursprünglich kontinuierlichen Signals
- Quantisierungsfehler entstehen, da nicht alle Zwischenwerte exakt erfasst werden können
A: Die Bandbreite des Eingangssignals ist begrenzt.
B: Es steht nur eine begrenzte Anzahl diskreter Werte zur Verfügung.
C: Es können nur ganzzahlige Frequenzen verwendet werden.
D: Es können nur Werte zwischen 0 und 1 genutzt werden.
Auflösung des A/D-Umsetzers
- Anzahl der möglichen digital darstellbaren Stufen
- Wird in Bit angegeben (z. B.
8 Bit = 256 Stufen,16 Bit = 65.536 Stufen) - Häufig wird die Hälfte der Werte für den positiven und die andere Hälfte für den negativen Bereich verwendet
A: 1024
B: 64
C: 8
D: 256
Jitter: Timing-Instabilitäten
- Jitter beschreibt kleine, zufällige Schwankungen in den Abtastzeitpunkten
- Ein instabiler Abtastratengenerator führt zu zusätzlichen Rauscheffekten im digitalen Signal
- Hoher technischer Aufwand ist nötig, um einen präzisen Takt zu gewährleisten
A: Aufgrund der großen Auflösung bleibt die Schwankung ohne Auswirkung.
B: Das Abschirmblech des A/D-Umsetzers wird durch Vibration störende Geräusche erzeugen.
C: Es entsteht zusätzliches Rauschen im Abtastergebnis.
D: Das Abtastergebnis wird verbessert (Dithering).
Digital-Analog-Umsetzer (DAC)
D/A-Umsetzer: Vom Digitalen zum Analogen
- Der D/A-Umsetzer wandelt einen digitalen Datenstrom (Samples) in ein analoges Signal um
- Genau wie der A/D-Umsetzer hat er eine begrenzte Auflösung (in Bit)
- Dadurch gibt es eine endliche Anzahl an analogen Signalwerten
A: 1024
B: 10
C: 100
D: 256
Auflösung und Spannungsbereich
- Die Anzahl der möglichen Stufen wird durch die Bit-Auflösung bestimmt
- Beispiel:
4 Bit → 16 mögliche Stufen - Ein D/A-Umsetzer arbeitet in einem festen Spannungsbereich (z. B. 0 bis
1 V ) - Bei einem linear arbeitenden D/A-Umsetzer verteilt sich der Spannungsbereich gleichmäßig auf die Stufen
Schrittweite (Quantisierungsintervall)
- Die Schrittweite berechnet sich aus dem Spannungsbereich geteilt durch die Anzahl der Stufen
- Beispiel: Bei 16 Stufen und einem Bereich von 0 bis
1 V ergibt sich eine Schrittweite von ca.6,25 mV
A: ca.
B: ca.
C: ca.
D: ca.
A: ca.
B: ca.
C: ca.
D: ca.
Anwendung von ADC und DAC
A/D- und D/A-Umsetzer in SDR-Systemen
- In SDR-Empfängern und Transceivern wandeln A/D-Umsetzer analoge Eingangssignale in digitale Daten um
- Die digitalen Daten werden verarbeitet und mittels D/A-Umsetzer wieder in analoge Signale umgewandelt
Nutzung des Wertebereichs
- Wird der volle Wertebereich nicht ausgenutzt, wird das Signal nur auf einen kleineren digitalen Bereich abgebildet
- Überschreitet das Eingangssignal den maximalen Bereich, kann der A/D-/D/A-Umsetzer nur bis zur maximalen Spannung korrekt abbilden
- Überschüssige Werte werden als Maximalwert (Clipping) dargestellt, was zu abgeschnittenen Signalanteilen führt
Einfluss der Auflösung
- Eine höhere Auflösung ermöglicht eine feinere Abbildung der Signalamplituden
- Eine niedrigere Auflösung führt zu einer gestuften, weniger genauen Rekonstruktion des Signals
Anti-Alias-Filter
Antialiasingfilter vor dem A/D-Umsetzer
- Vor dem A/D-Umsetzer wird ein Filter eingesetzt, um Signalanteile höherer Frequenzen zu unterdrücken
- Solche Filter werden als Antialiasingfilter bezeichnet
- Ziel: Vermeidung von Alias-Effekten durch Abschwächung unerwünschter Frequenzen
Filtertypen und Anforderungen
- Tiefpass- oder Bandpassfilter können eingesetzt werden
- Das Filter muss Signalanteile oberhalb der halben Sampling-Frequenz wirksam dämpfen
- Voraussetzung: Die Abtastfrequenz muss mehr als das Doppelte der zu erfassenden Signalfrequenz betragen
A: Hochpassfilter nach dem D/A-Umsetzer
B: Tiefpassfilter nach dem D/A-Umsetzer
C: Tiefpassfilter vor dem A/D-Umsetzer
D: Hochpassfilter vor dem A/D-Umsetzer
Rekonstruktionsfilter
Rekonstruktion durch den D/A-Umsetzer
- Wandelt digitale Samples zurück in analoge Spannungsstufen
- Samples werden in festgelegten zeitlichen Abständen wieder ausgegeben
- Vorgang: Rekonstruktion des ursprünglichen Signals
Stufenförmiges Signal und Filterung
- Zeitdiskrete Abtastung führt zu einem stufenförmigen Signal
- Unerwünschte höhere Frequenzen (Artefakte) können auftreten
- Einsatz eines Rekonstruktionsfilters (Tiefpass- oder Bandpassfilter)
- Filter unterdrückt alle Signalanteile oberhalb der halben Abtastrate
A: Tiefpassfilter vor dem A/D-Umsetzer
B: Tiefpassfilter nach dem D/A-Umsetzer
C: Hochpassfilter vor dem A/D-Umsetzer
D: Hochpassfilter nach dem D/A-Umsetzer
Fourier-Transformation
Fourier-Transformation und Signalzerlegung
- Signale können sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich dargestellt werden
- Im Zeitbereich: X-Achse → Zeit, Y-Achse → Spannung oder Leistung
- Im Frequenzbereich: X-Achse → Frequenz, Y-Achse → Amplitude oder Leistung
Zerlegung von Signalen
- Jedes Signal lässt sich als Überlagerung von Sinusschwingungen darstellen
- Jede Sinusschwingung hat eine bestimmte Amplitude und Phase
- Dieses Prinzip ermöglicht es, komplexe Signale in ihre Bestandteile zu zerlegen
Fourier-Transformation
- Mathematisch komplexes Verfahren, das ein zeitliches Signal analysiert
- Zeigt an, welche Sinus-Schwingungen (Frequenzen) im Signal enthalten sind
- Das Ergebnis wird als Frequenzspektrum dargestellt (X-Achse: Frequenz, Y-Achse: Amplitude/Leistung)
Fast Fourier Transformation (FFT)
- Effiziente Berechnung der diskreten Fourier-Transformation (DFT)
- Reduziert den Rechenaufwand erheblich
- Weit verbreitet in Soft- und Hardware zur Signalverarbeitung
Beispiel: Rechtecksignal und Oberschwingungen
- Rechtecksignale enthalten neben der Grundschwingung auch zahlreiche Oberschwingungen
- Diese Oberschwingungen (ungerade Vielfache der Grundfrequenz) nehmen ab, sind aber deutlich sichtbar
- Ohne Tiefpassfilter würden diese hohen Frequenzanteile stören
A: eines Widerstandswertes in einen diskreten Leitwert.
B: eines diskreten Widerstandswertes in eine Impedanz.
C: eines zeitdiskreten Signals in ein analoges Signal.
D: eines zeitdiskreten Signals in ein Frequenzspektrum.
Digitale Filter
Digitale Signalverarbeitung: Filter
- Digitale Informationen können nahezu beliebig bearbeitet werden
- Eingangssamples werden mittels mathematischer Funktionen in Ausgangssamples umgerechnet
- Filteroperationen können digital implementiert werden (z. B. Tief-, Band- oder Hochpass)
FIR-Filter (Finite Impulse Response)
- „Finite“ = Es werden nur eine begrenzte Anzahl von Eingangssamples für jedes Ausgangssample genutzt
- Keine Rückkopplung; Berechnung basiert ausschließlich auf aktuellen und vergangenen Samples
IIR-Filter (Infinite Impulse Response)
- „Infinite“ = Berechnung eines Ausgangssamples bezieht sich auf alle bisherigen Eingangssamples
- Einsatz von Rückkopplung führt zu einem theoretisch unendlichen Impulsverhalten
A: nicht in Hardware realisiert werden.
B: nicht in Software realisiert werden.
C: als FIR- oder IIR-Filter realisiert werden.
D: ohne Latenz realisiert werden.
I/Q-Verfahren
QAM und I/Q-Verfahren
- Digitale Modulationstechnik, die zwei Träger derselben Frequenz verwendet
- Einer der Träger ist um
90° phasenverschoben - Erzeugt ein Signal, das sich in Amplitude und Phase ändert
Erzeugung von QAM
- Zwei Träger:
- Einer wird mit dem I-Signal (In-Phase) moduliert
- Der andere, um
90° verschoben, mit dem Q-Signal (Quadrature)
- Beide modulierten Träger werden überlagert
- Das resultierende Signal ändert sich in Amplitude und Phase
Es entsteht ein, also ein neues Sinussignal mit einer Amplitude von $A=\sqrt{I(t)^2 + Q(t)^2}$ und einer Phasenverschiebung von $ \phi = \arctan\left(\frac{Q(t)}{I(t)}\right)$
|
$I(t)=$ |
50%
|
|
|
$Q(t)=$ |
50%
|
$A=$
Man kann das auch als Konstellationsdiagramm betrachten:
A: richtungsabhängige Änderung der Frequenz (bzw. richtungsinvariante Änderung der Amplitude)
B: separate Änderung der Amplitude des elektrischen und magnetischen Feldwellenanteils
C: nichtlineare Änderung der Amplitude (Quadratfunktion bzw. Quadratwurzel)
D: Änderung der Amplituden und Addition zweier um
A:
B:
C:
D:
I/Q-Verfahren – Senderseite
- Der digitale Datenstrom wird in zwei Teile aufgeteilt: I und Q
- Zwei D/A-Umsetzer wandeln die digitalen I- und Q-Werte in analoge Signale um
- Diese modulieren die beiden phasenverschobenen Träger, die anschließend kombiniert werden
I/Q-Verfahren – Empfängerseite
- Das empfangene Signal wird mit einem
0° -Träger gemischt, um das I-Signal zu extrahieren - Gleichzeitig erfolgt eine Mischung mit einem um
90° phasenverschobenen Träger, um das Q-Signal zu erhalten - Beide Signale werden A/D-umgesetzt und bilden so den digitalen I/Q-Datenstrom
A: Den Wechselstrom (I) in Abhängigkeit der Güte (Q) eines Schwingkreises bei seiner Resonanzfrequenz
B: Den Stromanteil (I) und den Blindleistungsanteil (Q) eines Signals
C: Die erste (I) bzw. die vierte (Q) Harmonische in Bezug auf ein normiertes Rechtecksignal
D: Die phasengleichen (I) bzw. die um
Abbildung des Frequenzbereichs
- Der I/Q-Datenstrom bildet den Frequenzbereich um eine Mittenfrequenz ab
- Beispiel:
435 MHz -Träger- Abtastrate von 10 Mio. Samples/s → Bandbreite =
10 MHz (±5 MHz um die Mittenfrequenz) - Abgedeckter Bereich: ca. 430 bis
440 MHz
A: -
B: -
C:
D:
Abhängigkeit der Bandbreite von der Abtastrate
- Die abgedeckte Bandbreite in Hz entspricht der Abtastrate in Samples pro Sekunde
A: -
B:
C: -
D:
A: -
B:
C: -
D:
Latenz
Verzögerungen in der Signalübertragung
- Bei der Signalübertragung und -verarbeitung entstehen Verzögerungen
- Lichtgeschwindigkeit: Zeit, die elektromagnetische Wellen vom Sender zum Empfänger benötigen
- Weitere Verzögerungen durch Zwischenspeicherung (Buffer) und Filter
Latenz in der Signalverarbeitung
- Laufzeit zwischen Sender und Empfänger oder zwischen Verarbeitungsstufen
- Latenz wird in Sekunden gemessen
- Typische Werte: wenige Millisekunden bis einige Sekunden
- Analoge Verfahren haben oft geringere Latenzen als digitale, da weniger Zwischenspeicherung erfolgt
A: Schwankung der Amplitude eines Signals in Volt pro Sekunde
B: Laufzeit bzw. Verzögerung eines Signals in Sekunden
C: Geschwindigkeit eines Signals in Metern pro Sekunde
D: Schwankung der Frequenz eines Signals in Hertz pro Sekunde